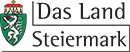Wasserknappheit in den Alpen
Ergebnis-Präsentation der länderübergreifenden Konferenz "Alp-Water-Scarce"
Graz (21. September 2011).- Heute Mittag (21.09.2011) wurden im Medienzentrum Steiermark die Ergebnisse der internationalen Abschlusskonferenz von "Alp-Water-Scarce", bei der von 20. bis 22. September 2011 Expertinnen und Experten in der Alten Universität Graz die Auswirkungen der Wasserknappheit auf die Wasserwirtschaft diskutierten, vorgestellt.
In einem länderübergreifenden, vom Alpenraumprogramm der EU finanzierten, Projekt, wurde von einem Konsortium, bestehend aus 17 Institutionen, an Konzepten und Lösungen im Umgang mit Wasserknappheit im Alpenraum gearbeitet. Die Bedeutung von Gebirgen als Wasserspeicher für Trinkwasser, Wasser für industrielle Nutzung, künstliche Bewässerung, Wasserkraftnutzung und andere Umweltdienstleistungen ist allgemein bekannt und nicht in Frage gestellt. In Europa sind es vor allem die Alpen mit ihren schier unermesslichen Wasserressourcen, die für die ökonomische und kulturelle Entwicklung nicht nur des Alpenbogens, sondern auch der umliegenden Flachländer und urbanen Haupteinzugsgebiete von unschätzbarer Bedeutung sind. Obwohl es scheint, als wären in der Vergangenheit Dürreperioden und Wasserknappheit in den Alpen nur kurzfristig und lokal begrenzt aufgetreten, hatte die anhaltende Dürre, die 2003 Teile Europas heimsuchte, auch signifikante Auswirkungen auf die Wasserressourcen der Alpenregion.
Der Einfluss des Klimawandels auf die Wasserressourcen der Alpen sowie zunehmende Wasserentnahmen wurden im Rahmen von „Alp-Water-Scarce" (Water Management Strategies against Water Scarcity in the Alps; Projektlaufzeit 1.10.2008 - 31.10.2011) untersucht und resultierten in einer Reihe von Handlungsempfehlungen für die Wasserwirtschaft sowie politische Entscheidungsträger. Basis für diese Empfehlungen sind Studien, welche in den 22 Testgebieten in Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien und in der Schweiz durchgeführt wurden: verschiedene Einzugsgebiete wurden hinsichtlich ihrer meteorologischen und hydrologischen Eigenschaften untersucht, sowie die anthropogene Wassernutzung (künstliche Bewässerung, Wasserkrafterzeugung, Trinkwasserversorgung, künstliche Beschneiung etc.) erhoben. Die Entwicklung dieser Wasserkörper wurde anhand der gewonnenen Daten und mit Hilfe von Modellrechnungen rekonstruiert und zukünftige Szenarien der Grundwasserneubildung errechnet. Desweiteren wurden Studien zum „optimalen ökologischen Abfluss" sowie zum Einsatz von Dürreindikatoren von aquatischen Ökosystemen gemacht.
All diese Resultate mündeten schließlich in die Etablierung von vier verschiedenen Frühwarnsystemen gegen Wasserknappheit die jeweils auf lokale Gegebenheiten angepasst wurden: 1) Im Einzugsgebietes des Arly (Haute Savoie, Frankreich) soll dieses Frühwarnsystem ein in die Zukunft gerichtetes Wassermanagement unterstützen 2) in Kärnten (Österreich) soll es eine nachhaltige Trinkwasserversorgung sichern 3) im Einzugsgebietes des Piaves (Italien) soll es Nutzungskonflikte zwischen landwirtschaftlichen Nutzern und Wasserkrafterzeugern vermeiden und 4) in Slowenien unterstützt es den sparsamen Umgang mit Wasser das für künstliche Bewässerung in der Landwirtschaft verwendet wird.
Darüber hinaus wurden Strategien und Maßnahmen zu Vermeidung von Wasserknappheit in der Landwirtschaft untersucht und evaluiert, sowie Indikatoren für eine Risikoabschätzung von Wasserknappheit in den „Alp-Water-Scarce" Untersuchungsgebieten vorgenommen. Durch die starke Miteinbeziehung von Betroffenen konnten Handlungsempfehlungen aus den Resultaten des Projektes abgeleitet werden die in deutscher, englischer, französischer, italienischer und slowenischer Sprache vorliegen. Ein „Handbuch für Wassermanager", eine praktische Anleitung zum Thema „Monitoring und Modelling in Gebirgsregionen" sowie ein interaktiver Atlas, der online abgerufen werden kann, fassen weitere Projektresultate zusammen.
Für Rückfragen steht Daniela Hohenwallner unter 0699/17236302 gerne zur Verfügung.
Graz, am 21. September 2011
Sabine Jammernegg unter Tel.: +43 (316) 877-2999, bzw. Mobil: +43 (676) 86662999 und Fax: +43 (316) 877-2294 oder E-Mail: sabine.jammernegg@stmk.gv.at zur Verfügung.
A-8011 Graz - Hofgasse 16 - Datenschutz